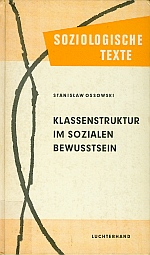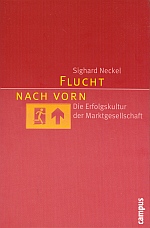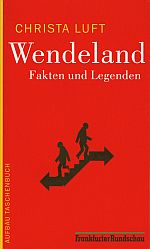Globalisierung aus Lochau
 Am 1. Juli jährt sich zum 207. Mal der Geburtstag des "Wunderkinds" Karl Witte. Der kleine Karl wurde im Jahre 1800 als zweiter Sohn des Dorfpredigers gleichen Namens im Pfarrhaus zu Lochau südlich von Halle geboren. Bereits 1810 wurde er mit einer Ausnahmegenehmigung in Leipzig immatrikuliert und als "früher Gelehrter" bestaunt. Vater und Sohn studierten in Göttingen weiter, die Studenten nannten Karl einen "Wunderbalg". 1814 wurde Witte junior auf der Durchreise in Gießen per Akklamation des Lehrkörpers promoviert, 1816 promovierte er noch einmal regulär in Heidelberg als Jurist. Vater Witte schrieb ein eher erfolgloses Buch über seinen Sprössling, der Junior lehrte bald unspektakulär als Jura-Professor in Breslau und Halle und tat sich nur noch als Dante-Forscher und -Herausgeber hervor.
Am 1. Juli jährt sich zum 207. Mal der Geburtstag des "Wunderkinds" Karl Witte. Der kleine Karl wurde im Jahre 1800 als zweiter Sohn des Dorfpredigers gleichen Namens im Pfarrhaus zu Lochau südlich von Halle geboren. Bereits 1810 wurde er mit einer Ausnahmegenehmigung in Leipzig immatrikuliert und als "früher Gelehrter" bestaunt. Vater und Sohn studierten in Göttingen weiter, die Studenten nannten Karl einen "Wunderbalg". 1814 wurde Witte junior auf der Durchreise in Gießen per Akklamation des Lehrkörpers promoviert, 1816 promovierte er noch einmal regulär in Heidelberg als Jurist. Vater Witte schrieb ein eher erfolgloses Buch über seinen Sprössling, der Junior lehrte bald unspektakulär als Jura-Professor in Breslau und Halle und tat sich nur noch als Dante-Forscher und -Herausgeber hervor. Das Ganze wäre kaum mehr der Rede wert, wenn nicht das Buch des älteren Witte seinen Weg nach China gefunden hätte. Nach der wirtschaftlichen Öffnung unter Deng Xiaoping war die revolutionäre Erziehung der Jugend nicht mehr so gefragt. Zudem hatte die "Ein-Kind-Politik" für zahlreiche Einzelkinder gesorgt, die nun geradezu nach autoritären, westlich orientierten Erziehungsmustern zu schreien schienen. Ein chinesischer Germanist mit einem völlig unaussprechlichen Namen machte in den staubigen Regalen seiner Fakultätsbibliothek den entscheidenden Fund: "Karl Witte, oder Erziehungs- und Bildungsgeschichte desselben; ein Buch für Eltern und Erziehende. Herausgegeben von dessen Vater, dem Prediger Dr. Karl Witte. Erschienen in zwei Bänden bei F. A. Brockhaus in Leipzig 1819."
Das war es doch: Wunderkind-Erziehung in Frage und Antwort für die ehrgeizigen Eltern, Spiele, Reime und Übungen für den Sprössling, protestantisches Arbeitethos pur in klaren Machtverhältnissen. Zitat Witte senior: "Unsere Familie war für ihn der Staat, ich der Regent desselben; und er ein Staatsdiener. Ich verlangte von ihm, dass er, zum Wohle des Ganzen, folglich zugleich seiner selbst, seine ganze Kraft anstrenge, d. h. seine Pflicht tue, und sich fähiger mache, künftig noch mehr leisten zu können. Deshalb wurde im Sittenbuche bloß vermerkt, dass er getan habe, was er tun sollte: seine Schuldigkeit."
Dengs Bürokraten waren begeistert, das Buch wurde übersetzt und millionenfach verbreitet. Seit 20 Jahren werden nun beinahe flächendeckend kleine Chinesen nach den Rezepten des Karl Witte senior traktiert und auf Universitäts-Karrieren in Übersee getrimmt. "Harvard Girl Liu Yiting" berichtet im gleichnamigen Buch, dass sie auf ihre Bewerbungen hin gleich vier Zusagen von vier amerikanischen Hochschulen bekommen hatte, die Entscheidung für Harvard fiel ihr nicht schwer. Auch die Eltern von "Harvard Boy Zhang Zhaomu" haben einen Bestseller geschrieben und alle schwören auf "Carl Weter's Educational Law", wie die kuriose Rückübersetzung des Titels des nunmehrigen Standardwerks lautet.
Dabei ist Wittes Original-Buch gar nicht einmal schlecht geschrieben und sogar von einem leicht bizarren Humor durchzogen. Alles begann mit einer weinseligen Wette an einem Lehrer-Stammtisch in der Magdeburger Altstadt: "Wenn mein Sohn gesund organisiert sein wird, so bin ich fest entschlossen, ihn zu einem ausgezeichneten Menschen zu bilden!" Besonders glückliche Naturanlagen? Schnurz! Genie ist Fleiß! Wer will, kann alles erreichen!
Domprediger Glaubitz wollte es nicht glauben und auch Oberlehrer Schmidt widersprach vehement. Es war die Abschiedsrunde von Witte senior, der bald darauf seine Pfarre in Lochau übernahm. Wittes erstes Kind starb wenige Tage nach der Geburt, das zweite war ein robuster kleiner Bursche, der etwas träge wirkte. Also genau das richtige Versuchsobjekt für den älteren Witte - er hatte mit den Magdeburger Kollegen gewettet und durfte nun nicht kneifen.
Der kleine Karl war mancherlei Gefahren ausgesetzt, fiel in einen Teich, wurde von einer Billardkugel getroffen, vom Pfau gekratzt, stürzte beim Stelzengehen und wurde vom Feuerwerk angekokelt. Und doch konnte nichts seine Entwicklung zum Wunderkind aufhalten - dank einer gesunden Lebensweise und den im Buch beschriebenen Methoden. Spielen und Arbeiten wurden streng getrennt: "wirklicher Unterricht" durfte heiter, aber nicht spielerisch sein. Das war "ernste Arbeit, bei der er alles geben" musste. Karl gewöhnte sich bald daran, "seine Arbeitszeit für heilig zu halten. Aber nicht bloß fortdauernd arbeiten musste er, sondern auch so kraftvoll und so schnell, als er es nur vermochte. Dies letztere hat insbesondere seinem Geiste eine besondere Schnellkraft gegeben."
Was der preußischen Obrigkeit nicht lange verborgen blieb. Der Merseburger Lehrer Landvogt prüfte Karl mit siebeneinhalb Jahren. Der "Hamburger Korrespondent" berichtete darüber, andere Blätter schrieben es ab, das Wunderkind wurde zum Medienereignis. Halles Universitäts-Kanzler von Niemeier äußerte sich skeptisch, von Senckendorf gab dem Kind Astronomieunterricht. Garlieb Merkel spottete über den "Gedächtnis-Helden", Wieland lud ein, Gutsmuths prüfte, Lafontaine und Voß polemisierten. Stadt und Universität Leipzig setzten Karl ein Jahresgeld aus. Meckel und Reil untersuchten das Wunderkind, konnten aber nichts Außergewöhnliches finden.
Wahrscheinlich hatte Witte senior seinen Sprössling nur relativ früh auf jene "Schnellstraßen des Lernens" gesetzt, die auch heute noch die pädagogische Landschaft durchziehen. Es folgten gemeinsame Studienjahre von Vater und Sohn. 1817 missriet eine Probevorlesung Karls in Berlin, wegen des Störverhaltens patriotischer Studiosi, die im "welschen" Wunderkind-Kult ihre Feindbilder bestätigt sahen. "Turnvater" Jahn selbst schrieb Spottverse, die der Senior dann in einer Mischung aus Empörung und Stolz in seinem Buch zitierte:
Er reicht sein Haupt dem Lorbeer dar,
der Rute seinen Steiß.
Zu wünschen bleibt, dass sich bald ein Verlag findet, der dieses unterhaltsame und lehrreiche Werk erneut in seiner Muttersprache herausgibt. Denn vielleicht ist es nur "Carl Weter's Educational Law", das chinesische Studenten ihren deutschen Kommilitonen im globalen Wettbewerb voraus haben?
stulli - 27. Jun, 23:32